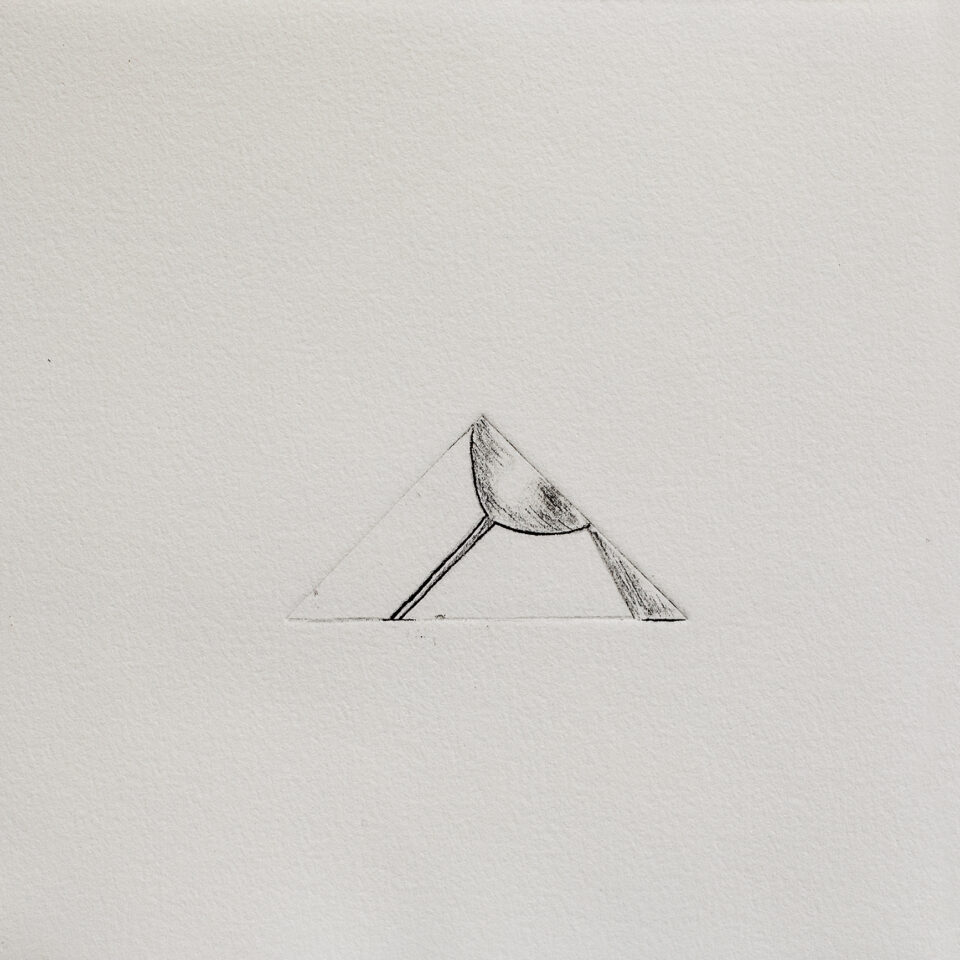(B)LOGBUCHEINTRAG VOM 02.02.2020: Über Gyros und Fortschritte.
Das heutige Datum besteht nur aus zwei Ziffern. 0 und 2. Ob heute viele Leute heiraten? Wie ist das eigentlich? Standesamtlich ja wohl eher nicht, die haben ja Sonntags eher weniger Bereitschaft, oder? Oder gibt es da Bonus- und Prime-Schemata, über die man sich sowas verdienen kann? „Verlängern Sie 3x Ihren Ausweis mindestens 6 Wochen vor Ablauf und Sie erwerben Anspruch auf eine Dienstleistung am Wochenende!“.
Die Nacht war anstrengend. Das Brummbett ging mir auf den Keks – trotz Ohropax. Darüber hinaus bin ich mit dem alten Mann auf meinem Zimmer gleichermaßen überfordert, als auch genervt. Er ist leider nicht sehr kommunikativ – was ich jetzt auch nicht zwingend voraussetze – aber leider auch sehr unselbstständig. Um 1:30 Uhr fing er an vor sich hin zu brabbeln. Durch meine Ohrenstopfen habe ich das erst nicht mitbekommen. Erst als er vehementer fragte, ob man das Licht anmachen könne, wurde ich wach. Leider bemüht der alte Mann seine Klingel nicht selbst – ich habe dann nach dem Pflegepersonal geklingelt, damit sie seine Bettausrichtung etwas verbessern. Danach kam ich selbst dann knapp 2 Stunden nicht wieder zur Ruhe. Habe stattdessen die Ostfriesenreihe von Klaus-Peter Wolf auf Audible weitergestreamt. Komm ich da wenigstens auch mal vorwärts. Wie gesagt: ich bin froh, wenn der ältere Herr morgen verlegt wird. Auch wenn es derb egoistisch klingen mag. Aber ich soll ja auch viel schlafen. Das klappt so aber auf jeden Fall nicht.
Die Mädels sind um 8:30 Uhr wach. Alex schickt mir ihre Tagwerksplanung per WhatsApp.
- 8:30 Uhr Frühstücken
- Dann schwimmen
- Danach zum Gyros-Spezialisten, Gyros holen
- Dann zu dir, im Innenhof der Klinik zusammen essen.
Ich freu mich drauf. Gerade auch jetzt im speziellen Fall, wo ich anscheinend fressen kann ohne Ende und trotzdem noch abnehme. Mein Stoffwechsel scheint durch den Krebs vor Therapie nämlich schon ziemlich runtergefahren zu sein. Denn trotz viel Salat, Bewegung und Reduktion der Zuckerzufuhr tat sich auf der Waage nix. Aber hey, für mich ist ja auch Gewicht halten schon ein Erfolg.
Bis die Mädels hier sind, werde ich mich noch etwas mit dem Onlineshop befassen. Mir ist über die wache Nacht noch eine gute technische Dienstleistung in den Sinn gekommen, die ich anbieten werde.
Á propos Technik: seit ich Mundschutz trage, erkennt mich mein iPhone nicht mehr mittels FACE-ID. Das ist doch Mist. Unausgegoren. Nicht ausgereift. Das wird sich nicht durchsetzen. So wie dieses Google.
Um kurz nach eins ist es soweit. Gyrostime mit den Ladies. Danach eine Runde um den Block. Die Kids können auf dem Spielplatz spielen. Mama und Papa chillen auf der Bank.

Nach der Rückkehr in die Klinik genehmigen wir uns noch einen Kakao bzw. Kaffee. Gegen 16:45 Uhr brechen die Mädels wieder auf.

Ich werde auf meinem Zimmer noch etwas Musik hören. Derzeit läuft das Curse-Album „Die Farbe des Wassers“ auf heavy rotation. Mit tiefgründigen Texten bringt es mich zum Nachdenken, (Selbst-)Reflektieren und Kraft tanken.

Zum Einschlafen gönne ich mir noch einen Filmklassiker. „The Crow“ von 1994. Herrje, wie lange habe ich den denn nicht mehr gesehen?!

Ich bin auf die Visite morgen gespannt und darauf, wie die Blutwerte sind. In der Hoffnung dann auch bald nach Hause entlassen zu werden.