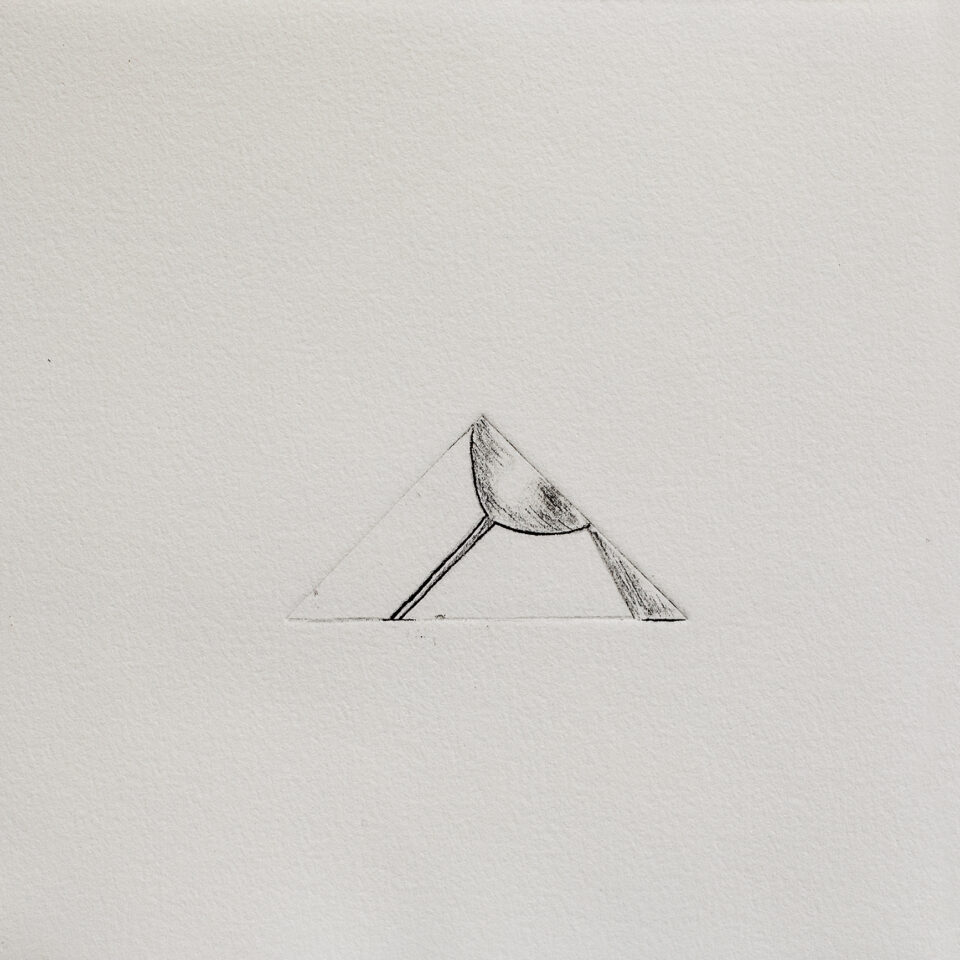Antihormontherapie reloaded
Vier Jahr befinde ich mich nun schon krebsfrei auf der Straße des Lebens nach Krebs.
Ich befahre die Antihormontherapieautobahn. Im Kofferraum meines Autos hab´ ich ein paar Medikamente. Manche eher sanfterer Natur. Vitamin D, Selen und Co.
Die Tamoxifentablette hat da schon etwas mehr Drive, ließ mich aber ziemlich unbeschadet umherdüsen. Die Trenantonespritze hingegen, die ich seit einem Dreivierteljahr bekomme, lässt mich tagweise abprupt abbremsen.
In diesem Blogtext erzähle ich davon, was die verschärfte Antihormontherapie mit mir macht. Ich gebe euch, liebe Leserinnen und Leser, einen offenen Einblick in den Psychostruggle der letzten Monate. Es geht um körperliche Beschwerden, depressive Verstimmungen und Besuche bei einer Psychotherapeutin.
Mein Text enthält phasenweise Dunkelheit, aber auch ganz viel helles Licht und nicht zuletzt Musik. Auf jeden Fall ist er voller Dankbarkeit. Denn ich darf dank Medizin und einem Quäntchen Universumsglück leben.
Liebe Leserinnen und Leser: Drückt auf den Lichtschalter oder zündet eine Kerze an und begebt euch auf eine Fahrt durch meine Gedankenwelt.
Wie alles begann…
Als ich nach der Bestrahlung in die Antihormontherapie geschickt wurde, hatte ich ziemliche Startschwierigkeiten. Ich war nach Operation, Chemotherapie, Bestrahlung parallel zur Coronapandemie und den Lockdowns einfach therapiemüde. Fast ein Jahr zwischen OP-Saal, Arztliege und sogenannter war eigentlich genug. Zumal ich nach der letzten Bestrahlung weiterhin alle drei Wochen eine Antikörperinfusion erhielt.
Mein Bauch schrie damals: „Nein, ich will keine Medikamente mehr nehmen.“ Aber da ich einen hochgradig aggressiven hormonell getriggerten Tumor gehabt hatte, wurde mir ausdrücklich die weitere Medikamentierung im Rahmen einer Antihormontherapie empfohlen.
Die ersten Tamoxifen-Tabletten nahm ich dann recht widerwillig ein. Aber nach einer tollen Begegnung mit einer Heilerin (Hier kannst du etwas mehr über meine engelhafte Begegnung lesen.), etwas Herumschrauben an meinem Mindset und vielleicht auch einfach etwas Annette-typischen Pragmatismus, fuhr ich nach etwas Geruckel im Gehirngetriebe einfach weiter auf der Antihormontherapieautobahn.
Im Vergleich zu Frauen, die einen Triple-negativen-Brustkrebs haben, konnte ich nach Chemotherapie und Co. aktiv etwas gegen ein Rezidiv tun. Ich selbst reduzierrte also mit dem Schlucken der Tablette die Gefahr. Wow, welch Segen! Da konnte es mir doch egal sein, dass ein paar Nebenwirkungszipperlein am Straßenrand aufleuchteten.
Ich arrangierte mich recht schnell recht gut mit der Situation und ich fuhr im gemäßigten Tempo weiter. In einem Blogtext kannst du dich tiefer in meine Gedanken während der Anfangszeit der Antikörper- und Antihormontherapie einlesen, wenn du dies gerne möchtest.
Hier geht es nun etwas geraffter weiter… Denn mir gelang es weder mit angezogener Handbremse noch mit Winterreifen, sondern im Normaltempo und medikamentös gut abgesichert wieder in mein neues altes Alltags-Berufs-Familienleben hineinzusliden.
Wenn ich andere Frauen über Gewichtszunahme, starke Stimmungsschwankungen, Knochenschmerzen oder andere Beschwerden sprechen hörte, war es mir manchmal fast schon unangenehm, weil bei mir alles so unkompliziert verlief.
Wobei dieses “unkompliziert“ wohl auch im Auge der/s Betrachters liegt. Denn an der Tatsache mit Anfang 40 von jetzt auf gleich in der Menopause und überhaupt im verführten Wechsel zu sein, hatte ich zu knabbern.
Was konnte ich selbst beisteuern, um da möglichst unbeschadet durchzubrausen? Ich optimierte mein ohnehin schon sehr hohes Bewegungspensum und meine Mahlzeiten gestalteten sich noch verspleenter (wie mein Göttergatte es auf Nachfrage wohl nennen würde). Zudem holte ich mir bei einer Heilpraktikerin noch alternativmedizinische Tipps.
Und ja, ich arbeitete an meinem Mindset. All vibes welcome, positives Denken und so.
Und ganz vielleicht, ja ganz vielleicht hatte ich auch einfach etwas Glück, dass ich recht schnell recht gut und auch recht lange mit der Tamoxifeneinnahme klarkam. Das Universum kann es ja auch einfach mal gut mit einem meinen, oder?
Summasumarum arrangierte ich mich also mit meiner „Krebs-Tablette“ und ging immer mehr und immer tiefer wieder rein in ein normales Berufs- und Alltagsleben.
In einem Interview auf der Herzwiese habe ich schon mal ein wenig ausführlicher darüber geplaudert, lies dich gern nochmal zurück zu einem anderen Moment auf meiner Krebsreise.
Da bahnt sich was an
Im zweiten Jahr der Tamoxifeneinnahme änderte sich dann etwas. Ich verspürte Anzeichen, die mir komisch vorkamen. Mal fühlte ich mich schwanger, dann wie kurz vor der Periode. Dann wie in der Stillzeit und dann wie nach der Periode.
Kurzum: Ich fühlte mich sehr weiblich. Aber genau das war komisch. Denn diese Weiblichkeit sollte ja eigentlich unter Tamoxifen in der Art gar nicht auftreten. Denn diese Tablette sollte ja meine Hormone in Schach halten, weil zu viele davon angesichts meines Brustkrebses, der nun mal hormoneller Art gewesen ist, nicht förderlich – oder deutlicher gesagt – gefährlich für mich sind.
Bei einer Nachsorgeuntersuchung sprach ich dann meine Gynäkologin darauf an, die hellhörig wurde, aber nicht überreagierte: „Wir beobachten das.“
Doch meine Empfindungen traten weiterhin auf und ließen mich immer häufiger in verwirrten Schlangenlinien über die Antihormontherapieautobahn fahren. Was war da nur los bei mir in mir?
Meine Gynäkologin reagierte dann bei meinem erneuten Bericht wieder nicht superaufgeregt, aber dennoch mit mehr Aktionismus. „Ok, das nehmen wir dann mit einer Hormonstatusbestimmung mal genauer in den Blick.“
Gesagt, getan. Hormonstatus bestimmt. Anruf erhalten. „Frau Holl, der Östrogenwert ist noch in Ordnung.“ Ich freute mich und speicherte – wie ich erst im Nachhinein so richtig realisierte – nur „Östrogenwert” und “In Ordnung.“ ab. Das “noch” hatte ich unbewusst-bewusst überhört. Und so ging ich beruhigter in die nächsten Monate.
Meine Beschwerden aber blieben… Wurden sogar noch mehr…
Deshalb wurde mein Hormonstatus ein paar Monate später erneut gescheckt. Diesmal hieß es dann:„Frau Holl, ihr Östrogenwert ist zu hoch. Da sollten wir noch mit einem weiteren Medikament gegensteuern. Sonst werden mir Ihre Eiersöcke zu aktiv. Ich rate zu einer monatlichen Spritze.“
Uff… Von dieser Spritze hatte ich schon oft gehört. Viele Bekannte in der Instagram-Krebs-Bubble erhielten die. Auch im persönlichen Umfeld kannte ich einige Frauen.
Die würde mich so richtig und endgültig in die künstlichen Wechseljahre versetzen, was Tamoxifen allein bei mir wohl noch nicht so ganz geschafft hatte.
Ach nö, darauf hatte ich ja so gar keine Lust. Die Spritze war schließlich nicht so harmlos wie die aus des Goldkinds Arztkoffer, sondern mit viel Nenbenwirkungswums gefüllt. Ich hatte von starker Gewichtszunahme gehört, von Libidoverlust, depressiven Phasen, Schmerzen an der Einstichstelle usw.
An dieser Stelle bedanke ich mich ausdrücklich und erneut bei meiner Gynäkologin, die mir durch ihre unaufgeregt-sachlich, aber hellhörig-wachsame Art, erspart hatte, dass ich mich schon monatelang mit diesen Gedanken herumgeschlagen hatte. Erst jetzt beschäftigte ich mich konkret damit, mit welchen Umwegen, Anstiegen oder auch Komplettsperrungen ich auf der Antihormontherapieautobahn ich mitunter rechnen müsste. Und das reichte ja auch. War doch gut, dass ich bisher in antihormoneller Normalgeschwindigkeit, phasenweise vielleicht sogar untertourig unterwegs hatte sein dürfen.
Jetzt besah ich mir die Begleiterscheinungen genauer, fragte andere Betroffene, bemühte auch Dr. Google und fragte nicht zuletzt auch meine Gynäkologin nach ihren konkreten Erfahrungen.
Mehr noch als vor den Nebenwirkungen, die mich mitunter vielleicht anstelle des Autos lieber mit dem Fahrrad oder gar gemächlich zu Fuß unterwegs sein lassen würden, graute mir zu diesem Zeitpunkt vor dem ständigen Gang zur Ärztin, um mir meinen Pieks abzuholen.
Die Tamoxifentablette war klein, lag in einem Täschchen auf meinem Nachttisch und war irgendwie schon so integriert in meinen Tagesablauf, das sie normal war. Aber nun monatlich bei der Gynäkologin aufzulaufen, zeichnete vor meinem geistigen Auge das Bild einer “echten Krebspatientin”.
Damit einher ging ganz viel Wut – „Warum ich?” – in Kombination mit einem ohnmachtlosen Gefühl von „Ich hab´ doch sowieso keine andere Wahl. Ich muss dieses Medikament ja nehmen.Sonst kommt der Krebs mit hoher Wahrscheinlichkeit zurück.“ Und dann setzte sich auch noch die Angst in den Fond des Autos und raunte mir zu: „Was, wenn in den letzten Monaten schon was gewachsen ist, weil du die Spritze noch nicht genommen hast?”
Als dann auch noch ein unkenrufendes Männchens die Autotür öffnete und gehässig rief:„Du kannst dir doch sowieso nicht sicher sein, dass das hilft. Wenn der Krebs will, dann kommt er wieder.“ war alles aus.
Einige Tage lang war ich sehr nachdenklich, schlecht gelaunt, traurig und ängstlich. Aber dann ließ mein Kopf mich bremsen und legte mir Fakten auf den Tisch.
- Meinen Hormonstatus hatte ich schwarz auf weiß. Der ließ sich nicht leugnen.
- Mithilfe der Medikamente konnte ich ihn zum Guten verändern.
Es gab zwar keine hundertprozentige Garantie dafür, dass ich mit der Medikamentierung lebenslang safe sein würde. Aber ie Studienlage sagte ganz klar, dass jeder Tag mit antihormonellen Medikamenten zur Minderung meines Rezidivrisikos beitragen würde.
Ich konnte also hier und jetzt und jeden Tag aktiv etwas für ein gesundes Leben tun. Eine mehr als tolle Chance, die da vor mir lag, oder?
Je mehr ich diesen Gedanken zuließ, desto glitzernder erschien mir die Spritze und aus dem „Ich muss.“ wurde ein „Ich sollte.“ und dann gar ein „Ich will tun, was ich für ein gesundes Leben tun kann.“ Das fühlte sich dann schlussendlich wie ein Geschenk an und ließ mich voller Dankbarkeit sogar „Ich darf die Spritze nehmen.“ denken.
Yes, da waren sie wieder, die Modalverben, über die ich schon mal einen Text geschrieben hatte. Auch im neuesten Buch der Schlagfertigskeitsqueen Nicole Staudinger „Bin fast fertig, muss nur noch anfangen“, das genau zu richtigen Zeit in mein Leben purzelte, begegneten sie mir wieder. Herrlich!
Durch dieses Buch kenne ich nun nicht nur den wundervollen Ausdruck„ Pack-an.“, sondern bekam den richtigen Input oder – weniger liebevoll, aber treffender – den perfekten Tritt in den Hintern. Frau Staudinger ebnet der Leserschaft darin auf ihre unschlagbar ehrliche Art den Weg hin zu einem Leben, in dem man machen will, was man vermeintlich machen muss und den Rest einfach bleiben lässt.
Klar, auch wenn das Buch im schönen roten Layout daherkommt und meine Gedanken mir absolut löblich vorkamen – ich wusste nicht, ob mein Plan vom langen gesunden Leben aufgehen würde. Auch eine “Ich-will-Entscheidung“ würde diesen nicht tausendprozentig absichern.
Aber ganz nüchtern betrachtet und plakativ gesagt: Das liegt glücklicherweise außerhalb meiner und außerhalb jederfraus und jedermanns Entscheidungsgewalt. Da haben der Zufall, das Glück, eine göttlich-universelle Macht und auch das Schicksal auch noch ein Wörtchen mitzureden. Und das ist auch gut so.
Tja, am Ende meiner Überlegungen sprachen dann nüchterne Fakten sowie mein ureigenes Bauchgefühl sich für die Medikamente aus. Und damit schlussendlich für das Leben. Für mein Leben. Dem ich noch viele, viele, viele, viele Tage geben wollte.
Ich rief meine Gynäkologin an: „Ziehen Sie schon mal die erste Spritze auf, liebe Frau Dr. H., ich komme schon bald in Ihre Praxis!“

Der erste Pieks
So weit so gut. Mein Bauch und der Kopf sich ausgetauscht. Das Grummeln im Bauch hatte nachgelassen, der Kopf das Kommando übernommen. Ich fuhr wieder im Normaltempo auf der Antihormontherapieautobahn.
Und somit war ich also bereit für die erste Spritze.
Meine Gynäkologin hatte mich in einem Anruf noch darüber informiert, dass ich anstelle einer monatlichen Gabe auch ein 3-Monats-Präparat erhalten könne. Dies würde doch ggf. besser in mein volles, trubeliges, terminlich getaktetes Leben passen. Ja, das erschien mir eine gute Alternative zu sein. Und so sollte ich nun im Wechsel eine Spritze bei ihr in der Praxis bekommen, wenn ich sowieso zur Nachsorge-, Vorsorge- oder „ein paar-Tage-vorher-schon-Sorge-Untersuchung“ käme. Die nächste dann bei meiner Hausärztin und dann wieder bei ihr.
Ja und dann war er da,der Tag der ersten Spritze. Und mit ihm war da tatsächlich auch das Gefühl der “echten Patientin“. Wie zu Chemozeiten verweigerte ich mir an diesem Tag meinen geliebten Kaffee und blieb stattdessen bei Tee und Wasser. Ich verspürte eine leichte Nervosität und fieberte dem Nachmittagstermin aufgeregt entgegen, hatte aber gleichzeitig keine Lust, dass die Zeit verging. Ich spürte ganz tief in mich hinein: Kratzte es da nicht ein wenig im Hals? Verspürte ich nicht leichtes Bauchweh? War womöglich eine Erkältung oder gar Magen-Darm-Grippe im Anmarsch und es wäre besser, den Termin nochmal zu verschieben?
Hm, um ehrlich zu sein: Nein und nein und nochmals nein! Da war absolut überhaupt gar nichts zu spüren, was ungut sein könnte. Vielleicht etwas Müdigkeit, aber das war dem fehlenden Koffein geschuldet.
Und so war es dann eben, wie es war: Die Zeiger der Uhr drehten sich, die Teetassen leerten sich und schließlich saß ich im Auto. Meine Lust auf den Termin ging gegen Null. Aber wie schon die Oma von Nicole Staudinger aus oben zitiertem Buch zu sagen pflegte „Dann mache ich es eben ohne Lust.“ Punkt.
Es half ja nichts. Die Entscheidung war getroffen. Der Termin vereinbart. Ich wollte, dass ich es musste und morgen wäre es nicht besser als heute damit zu starten. Im Gegenteil: Jeder Tag Medikamentierung ist ein Tag mehr, um das Rezidivsicherheitsnetz zu spinnen.
Tja und dann war ich in der Praxis, erhielt ein Rezept, mit dem ich dann zunächst in die Apotheke ein Stockwerk darunter ging und holte mir das gute, teure Stück Lebenselixier mit pieksigem Ende. Wieder oben ging es fast direkt auf die Liege, die Spritze wurde aufgezogen und mit dem Spruch „Ach ja, Frau Holl, Sie haben halt wenig Bauchfett. Vielleicht gibt das jetzt einen Pieks!“ wurde mir dann das erste Mal Trenantone eingeflößt.
Ich hatte im Vorfeld ein paarmal den Tipp bekommen, mir ein Schmerzpflaster zu besorgen und aufzukleben. Ich hatte sie besorgt, aber aufs Aufkleben hatte ich verzichtet. Ich wollte beim ersten Mal erstmal ausloten, wie schmerzhaft das Ganze wäre.
Und …. Hm… Was soll ich sagen? ….. Eigentlich…. Also …. Äh…. Nun ja….. Mir wurde warm um die Einstichstelle herum und der Vorgang dauerte kaum länger als ich für das Buchstabieren von T-r-e-n-a-n-t-o-n-e gebraucht hätte.
Ich fuhr nach Hause. Aß eine große Schüssel Jogurt mit Obst, Nüssen und Haferflocken und dem gesunden Schuss Leinöl zu Abend und ging früh schlafen.
Liebe Leser*innen, ich muss euch enttäuschen: Dramatischer und spektakulärer wird meine Spritzenerzählung nicht. Denn auch wenn ich Autorin bin und gerne mit Worten spiele: Es gibt hier tatsächlich nicht mehr zu berichten.
Ich ging am Abend des ersten Spritzentages ins Bett, schlief genauso gut oder schlecht wie sonst auch und hatte an den nächsten Tagen eine Art Bauchmuskelkater.
Danach tauchte der nicht mehr auf und ich habe nun schon mehrere Trenatoneladungen bekommen. Außer gaaaanz leichten Verfärbung an der miniminiminikleinen Einstichstelle bemerke ich äußerlich nichts.
Also viel heiße Luft und unnötiges Kopfkino um eigentlich nichts?
Für den Moment schien es so, als hätte ich unnötige Überholmanöver auf der Antihormontherapieautobahn gestartet….
Vom Aua in den Händen, Hitzewallungen und schwachen Knochen
Ja, für den Moment schien es so, ja.
Allerdings schlichen sich mit den Monaten doch einige körperlichen Zipperlein ein, die mich immer wieder Vollbremsungen auf der Antihormontherapieautobahn einlegen ließen. Manche sind mittlerweile etwas besser geworden, manche sind stetige Begleiter. Deshalb bleibe ich hier in der Präsensform.
- Ich schlafe sehr, sehr schlecht. Ruf mich gern um drei nachts an oder verabrede dich um halb fünf mit mir zum Spaziergang, passt. Ich bin sowieso wach.
- Die Gelenkschmerzen (Ellenbogen, Knie) nahmen zu.
- Meine Füße, Waden und Arme schwellen phasenweise äußerst schmerzhaft an.
- Meine Armbänder und Strümpfe sitzen an manchen Tagen enger und ich bekomme die Fingerringe nicht angezogen. Das sieht keine/r, spannt aber.
- Ich bekomme immer wieder zu hören „Du bist dünn, nimmst von den Medikamenten nicht zu.“ Das stimmt, kilomäßig nicht, aber dennoch habe ich Ich-fühle-mich-so-aufgebläht-Tage. es nervt trotzdem, weil es ziemlich spannt.
- Meine rechte Hand tut mir oft weh und die Finger verkrampfen sich. Für eine Autorin und Bloggerin eine beängstigende Tatsache.
- Ich habe nachts Hitzewallungen. Unangenehm, klebrig, doof.
- Meine Haare werden dünner und fetten nicht mehr. Tägliches Haarewaschen kann ich getrost anderen überlassen. Spart Wasserkosten.
- Die Schleimhäute im Intimbereich sind sehr trocken. Ein Hoch auf Feuchtcreme.
- Mein Haut weist immer mehr Altersflecken auf. Zum Glück bekomme ich im Sommer auch noch Sommersprossen und hab sowieso schon einige Muttermale. Somit reihen sich die Flecken nahtlos in das gepunktete Gesamtbild ein.
- Insgesamt weise ich mehr Falten auf. Aber da halte ich es mit Johannes Oerding, der behauptet, dass die schönen Falten im Gesicht doch nur zeigen, dass im Leben viel gelacht wurde. Ein so schöner Gedanke.
- Ein Dreivierteljahr nach der ersten Spritze befinde ich mich urplötzlich in einer Schilddrüsenunterfunktion und musste die Dosis meiner Schilddrüsentablette erhöhen, die ich seit fast 20 Jahren täglich einnehme da ich eine Hashimoto habe. Ob dies in Zusammenhang mit der Antihormontherapie steht oder nicht, weiß ich nicht. Aber Recherchen im Internet (auf seriösen Seiten!) und im Gespräch mit der “Schilddrüsenärztin” bringen die Schlagworte Brustkrebs, Antihormonterapie, Schilddrüse mitunter in Verbindung. Aber bitte! Ich betreibe keinen medizinisch-fachlicher-Blog, sondern meine ureigene Erfahrung. Bitte geht ins Gespräch mit euren Ärzt*innen und holt euch konkreten Rat.
Weniger schön war das Ergebnis einer Knochendichtemessung, die ich vor Beginn der Trenantone-Therapie auf Veranlassung meiner Gynäkologin machte. Das sagte eindeutig, dass ich mich in der Osteopenie befinde, der Vorstufe zur Osteoporose.
Ob infolge der Bestrahlung, durch das Tamoxifen, den natürlichen Alterungsprozess, meiner fleischarmen Ernährung, vielleicht auch einer Veranlagung oder höchstwahrscheinlich einer Kombination aus allem, ist schlussendlich egal. Ich war kurz vorm Explodieren und gleichzeitig nahe am Lachkrampf. Von wegen „starke Frau“!
Meine Knochen sind also schwach. Und der bevorstehende Hormonentzug würde sie noch schwächer machen. Mich vielleicht sogar schon bald in die Sackgasse der Osteoporose einfahren lassen.
Hm, da ich die nächsten Jahre mit der Antihormontherapie beschäftigt sein werde und mich dann danach altersmäßig sowieso im echten Wechseljahrstatus befinden werde, mussten Lösungen her, was ich dagegen tun konnte.
Der Arzt meinte ganz freundlich: „Frau Holl, denken Sie an viel Bewegung, Krafttraining und vitaminreiche Ernährung. Und sehen Sie es doch positiv: Noch haben Sie keine Osteoperose“….. Ich hätte losbrüllen können. Dazu fiel mir nämlich nichts ein. Nur die Kinnlade herunter. Das ist nun das Ergebnis von jahrelangem Sportprogramm, gesunder Ernährung und drogenfreier Jugend? Da hätte ich in der Vergangenheit doch mal das Hotelbuffet leerfuttern, mich in der Raucherecke aufhalten oder einfach mal auf dem Sofa abhängen können. Hat ja anscheinend nichts gebracht. Und was bitte soll positiv daran sein, wenn ich mit einer weiteren Diagnose auf meinem Befundzettel nach Hause gehe?
Als dann auch noch einer mit dem Spruch: „Sei doch froh. Es hätte ja viel schlimmer kommen können.“ Um die Ecke kam, war es aus mit Selbstbeherrschung und „Annette-hat-das-doch-alles-gut-im-Griff.“
Logisch: Schlimmer geht immer. Aber… Wenn du in der Bestrahlung steckst, dann hilft es dir nicht, wenn man dir sagt, dass eine Chemotherapie doch viel mehr reinzieht. Denn ein Spaziergang ist es definitiv auch nicht.
Wenn du dir den Fuß verstauchst, ist es sicherlich weniger schlimm, als wenn dein Bein gebrochen ist. Aber Schmerzen hast du dennoch.
Von daher: Ich war traurig, sauer, schlecht gelaunt. Ließ mich fallen in die Bad Vibes. Die mir im Übrigen genauso willkommen sind wie die guten. (Toxische Positivität und so… An anderer Stelle hier auf meinem Blog mehr dazu).
Ein paar Nächte später, ein paar Gedankengänge weiter und mit etwas mehr oben-drüber-Sicht als mitten-drin-Stecken war mir klar, dass das schon alles machbar ist und ich es handeln werden kann. Denn zum Glück tauchen ja nicht alle Symptome zur selben Zeit auf und ich würde das schon alles in den Griff bekommen.
Und so ging ich voller Power „all in“ für ein langes Leben und packte mir eine Tasche voller Power für mein körperliches Wohlbefinden. Darin stecken
- ganz viel calciumreiches Mineralwasser. Wichtig für die Knochen.
- Riesenmengen an vegetarisch Buntem. Schließlich ist Brokkoli sowieso die Lösung bzw. das Antikrebs-Powerfood.
- Bewegung, Bewegung, Bewegung – täglich, egal bei welchem Wetter und bei welcher Laune
- absolut kein Alkohol mehr. Probiere mich gerade durch alkoholfreie Sekts und Cocktails durch. Da gibt es durchaus leckere Alternativen.
- Hanteln für den Muskelaufbau und -erhalt
- etwas kosmetische Hilfe. Faltencremes und Co. lassen grüßen. Und ich gönne mir nun regelmäßig eine Gesichtsbehandlung hier in der Nähe – und nicht nur wie bisher, wenn ich im Hotel bin.
- Pillendöschen mit Vitamin D, Selen und Magnesium
- mein orangener Heiltrank Lavita (Werbung aus Überzeugung und absolut selbstbezahlt), den ich seit der Chemo jeden Tag trinke
- ab und zu eine heilenergetische Fußmassage für die Seele
- Wellness-Zeit bei meiner Lieblingsphysiotherapeutin
Mir helfen diese Dinge. Mir tun sie gut. Mir reichen sie aus. Sie sind auf mich, meinen Körper abgestimmt und von meiner manchmal vielleicht etwas seltsam anmutenden “da-muss-ich-halt-durch-Haltung” geprägt.
Bitte liebe Leserin, lieber Leser, falls du selbst in einer Anti-Hormontherapie bist, dann sieh den Inhalt meiner Power-Tasche nicht als Aufforderung zur Nachahmung oder gar als Anleitung für dich an. Pack dir bitte die Dinge in deine persönliche Nebenwirkungsbekämpfungstasche, die dir persönlich helfen und gut tun.
Die Idee von Nicole Staudingers Oma, Dingen , die man ungern macht oder vor lieber aufschieben möchte mit einem lapidaren „Dann machst du es eben ohne Lust.“ zu begegnen, habe ich schon lange in meinem Mindset etabliert. Und in punkto Antihormontherapie kommt mir dieses Mantra sehr gelegen.
Vielleicht hast du aber weitaus stärkere Schmerzen, weitaus stärkere Belastungen, dann reicht dir meine mit etwas Positivität gespickte medizinische Soft-Edition möglicherweise oder eher ganz bestimmt nicht aus. Hol du dir bitte das, was dir gut tut!
An dieser Stelle verweise ich auch gerne auf meine Interviews mit Kirsten und Antje, die sich ebenfalls mit Tamoxifen und Co. auskennen. Die erzählt von ihren jahrelangen Erfahrungen mit der Antihormontherapie und hat zahlreiche Tipps auf Lager, was man gegen die Begleiterscheinungen tun kann.
Watte im Kopf
Die körperlichen Beschwerden konnte ich also gut anpacken. Ich schaffte es sogar, meine anfängliche Wut gegen meinen Körper, der schwächer wurde, der seine Dienste nicht mehr so problemlos tat, wie ich es erwartete, in friedliche Selbstliebe umzumünzen.
Er trägt mich schon ewig durchs Leben und nicht immer habe ich ihn gut und fürsorglich behandelt. Auch während und nach meiner Erkrankung nicht. Er war und ist für mich eher ein Dienstleister als ein geschätzter Freund. Aber eigentlich könnte ich, nach allem, was er schon für mich getan hat, stolz auf ihn sein. Nein, ich sollte stolz auf ihn sein. Oder neee: Ich bin stolz auf meinen Körper inklusive seiner porösen Knochen, Lach- und Sorgenfalten, kleiner Brüste, wilder Haare und und und.
Ok, check – ich hatte mich pragmatisch-realistisch, aber auf keinen Fall resigniert, sondern aus eigenem Willen und Antrieb mit den körperlichen Wehwechen abgefunden! Und so erfreute Annette sich ihres Lebens, nahm jeden Abend eine Tablette, jeden Morgen ein paar Vitamine und alle drei Monate gab´s eine Spritze. Alles easy, alles roger?
Hm… Manchmal entfielen mir Namen und Bezeichnungen von Dingen. Das beängstigte mich, kannte ich es doch aus der Chemo. Ich sag´euch, es ist ein gruseliger Moment, wenn du ein/e Schüler/in anschaust, dir ihr/sein Name auf der Zunge liegt, aber er nicht herauskommen will. Zum Glück ist er dann aber spätestens am nächsten Schultag wieder da.
Mein Kopf war weiterhin zum klaren Denken fähig – ein Glück, was wäre denn sonst mit meinen Blogtexten. Und dennoch, an manchen Tagen fühlte es sich in meinem Oberstübchen seltsam benebelt an und die Welt zog an mir vorbei. Es war, als würde ein Wattebausch meinen Kopf ausfüllen. Dann war ich angestrengt. War ich müde. Und noch häufiger schlechte Laune und keine Lust. Zu nichts.
Leider häuften sich diese Wattetage immer mehr. Selbst im Familienurlaub an der Küste waren, beim Joggen im bunten Herbstwald und in der sonst von mir geliebten und dekorativ-musikalisch und überhaupt zelebrierten Adventszeit war ich genervt und weinerlich.
Vielleicht ließ ich mich unbewusst auch gerne in die Watte hineinfallen. Eine Runde Mitleid für die arme Annette ist ja irgendwie auch mal ganz schön, oder?
Aber ich stellte fest, dass es immer un-guter wurde… Eigentlich war ich am Dauermeckern. Im Wechsel mit Weinen. Und dann begann auch noch das In-Frage-Stellen.
Was war denn mit mir los? Hatte ich ein Burnout? Eine Depression? Eine Posttraumatische Belastungstörung?
Ich betrieb Ursachenforschung. Googelte. Sprach meine Gynäkologin darauf an. Fragte andere Betroffene.
Das alles tat gut. Denn unter dem Stichwort „Watte im Kopf“ gab es 499 000 Treffer. Dann stieß ich auf den Begriff „Brainfog“ und erfuhr, dass es zig, zig, zig und noch mehr Frauen genauso geht. Ich hörte mich in meinem eigenen krebsigen Bekanntenkreis um, schrieb einen Instapost. Und bekam daraufhin viele Nachrichten von Faruen, die genau dasselbe Phänomen beschrieben, das ich erlebe: Tageweise im Nebel, dann wieder total klar. Ich fand sogar wissenschaftlichen Text von Forscher*innen an der Universität Rochester.
Was soll ich sagen? Das änderte nichts an meiner Fahrt mit schlechter Sicht. Aber es nahm mir schlagartig etwas von der Benommenheit. Ich war nicht allein. Ich bildete mir das nicht ein. Die Medikamente forderten ihren psychischen Tribut.
Das wattige Gefühl wurde angenehmer. Die Watte war durchlässiger und ich konnte wieder klarer denken: Ein Absetzen der Medikamente war für mich keine Option. Die Situation war, wie sie war und es war nun an mir zu lernen, diese zu akzeptieren, im besten Falle anzunehmen und im Optimalfall ein paar mentale Hacks zu entwickeln, um den Blick nach vorne nicht zu verlieren.
Der Brainfog war also eine normale Begleiterscheinung meiner Medikamente. Er würde fortan zu mir gehören.
Ich wollte aber die Summe der Wattetage keinesfalls noch mehr erhöhen. Denn das Leben bot mir o viel. Und das wollte ich auf jeden Fall mit wachem Kopf erleben. Deshalb strebte ich eine Lösung oder zumindest eine Optimierung meines Watteproblems an.
Und hierzu begab ich mich auf einen professionellen Weg.
Mit professioneller Hilfe ins Scheinwerferlicht
Ich hatte selbstverständlich schon Rat in meiner Selbsthilfegruppe bei Jung und Krebs e.V. gesucht und gefunden (Danke!) und hatte meine Instagramkrebsbubble, wo ich auf viele Leute traf, die meine Symptomatik kannte. Mein Post über den Brain Fog erhielt viele Likes, Kommentare und ich sogar eine Anfrage einer Online-Plattform für ein Video dazu.
Alles gut, alles recht. Schön, wenn es vielen so ging und ich mit meinen Problemen nicht alleine war. Dennoch wollte ich ja meine Situation verändern oder vielmehr verbessern. Ich wollte wieder mit mehr Freude auf Lebensautobahn unterwegs sein. Denn so langsam wurde ich mir selbst unsympathisch und war für meine Herzensgang sicherlich eine sehr anstrengende Person, auf die man auch gern mal als Mamataxifahrerin verzichtete und lieber zu Fuß oder mit dem Fahrrad loszog, weil die Mutter zu meckrig am Start war.
Irgendwann mochte ich das alles und mich selbst nicht mehr und wusste: „So kann das nicht weitergehen!“. Mir wurde klar, dass Nicole Staudinger recht hatte, wenn sie meinte, dass der „[mein] Kopf die größte Herausforderung [ist], wenn es darum geht, dauerhaft gute Entscheidungen für [mich] zu treffen.“
So sah es wohl aus: Zwar hatte ich die Entscheidung über die Medikamenteneinnahme bewusst getroffen, aber die längerfristige Umsetzung und vor allem das Klarkommen mit den daraus resultierenden Nebenwirkungen „erforderte Training wie alles im Leben.“ Danke, Frau Staudinger, diese sportliche Metapher passt für mich Bewegungsfan perfekt.
Doch während das tägliche Steppen auf dem Crosstrainer oder das Joggen für mich ritualisierte Routine war, egal, was Wind, Wetter oder Allgemeinbefinden hergaben, fühlte ich mich in Anbetracht der Kopf-in-Watte-Tage überfordert.
Zwar hatte ich mir in den letzten Jahren ein stabiles Mindset zusammengeschustert und mein Resilienzlevel war sicherlich auch nicht low. Dennoch gestand mir ein, dass ich nun doch etwas mehr als Selbsthilfegruppen-Gesprächen, Krebsbubbleaustausch oder Coaching-Mindset-Ratgeber-Lektüre brauchen würde (Wobei das neunte wie auch alle anderen Bücher von Frau Staudinger und ein, zwei, neunzig andere Mindsetbücher, mir schon über so manche Panne auf der Leben-nach-Krebs-Straße hinweggeholfen haben).
Mein positives Mindset und gutes Körpergefühl waren mir entglitten.
Ich wollte – nein, ich durfte! (Hihi, die Modalverben lassen wieder grüßen!) – mir professionelle Hilfe holen. Das sah auch meine Gynäkologin so, die mir den Kontakt zu einer Psychotherapeutin mit gynäkologischem Hintergrund gab, die noch dazu nicht übermäßig viele Kilometer entfernt praktizierte. Volltreffer also.
Falls du meinem Blog schon länger liest und dich jetzt fragst: „Häh, hatte Annette nicht schon mal von einer Therapeutin oder gar Psychoonkologin geschrieben?“ Ja, das hatte ich und zwar hier! Und ja, ich hatte in der Vergangenheit schon psychotherapeutischen Beistand. In letzter Zeit nicht mehr. Kurzzusammenfassung: Therapeutin wurde schwanger. Zweimal Anlauf mit anderer Therapeutin/Coachin gestartet, hat nicht gepasst. Dann viel Austausch in und durch die Selbsthilfe und in der Instagramkrebsbubble. Ging auch eine Weile gut so.)
Ich hatte Glück (oder konnte den Privatpatient*innenbonus nutzen?), recht zeitnah einen Termin zu bekommen. Erste Email Mitte November, erster Termin Mitte Januar. Tipptopp!
Klar, ein paar Wochen dauerte es doch noch. Ein paar Wochen, in denen ich mich immer häufiger dabei ertappte, wie ich beim Autofahren laut sang oder mich so dankbar fühlte, weil der Sonnenaufgang ach-so-schön war. Allerdings begann ich nach wie vor plötzlich wie aus dem Nichts an allem herumzumeckern oder auch zu weinen. Das Leben nach Krebs unter Hormontentzug ist manchmal ganz schön kurvig oder mit Schotterbelag sehr unbequem.
Ich war oft so unsagbar müde. Selbst an Weihnachten wollte ich mich einfach nur ins Bett legen. Mir die Decke über den Kopf ziehen. Nicht darüber nachdenken, was ich 2024 erlebt und gesehen, beruflich geleistet, neu gekauft und schon gar nicht in Worte fassen, was ich Großartiges für mich erkannt habe. Auch wenn es da sicherlich das ein oder andere und ganz bestimmt noch viel mehr gegeben hatte.
Und dann besserte sich mein Befinden zwischen den Jahren immer mehr und sehr rasant. Ob es das Winterwetter mit Gitzerschnee und Sonnenschein war? Die zwei runden Familiengeburtstage, die mir den Wert der Gesundheit erneut ganz tief ins Bewusstsein rückten? Möglicherweise spielte auch der inspirierende New-Year-Schreibworkshop von den Kurvenkratzern und der wundervollen Claudia Poguntke Rolle? Oder war es diese besondere Stimmung zwischen den Jahren, die so träge und gleichzeitig verheißungsvoll daherkommt? Nicht zuletzt trug die terminliche Leere im Familienkalender auch dazu bei.
Schlussendlich weiß ich es nicht. Und es ist eigentlich auch egal.
Viel wichtiger war doch, dass meine Gedanken zur Ruhe und gleichzeitig wieder in Gang kamen und ich mich wieder aufs Fahren auf der Lebensautobahn konzentrieren konnte. Dass sich klammheimlich sogar eine leichte Zuversicht in mein Herz schlich. Schön.
Je näher der Termin bei der Psychtherapeutin kam, desto mehr Bock aufs Leben und Elan für neue Projekte hatte ich. Es hatte ein bisschen was vom “die-Zahnschmerzen-sind-so-schlimm-und-ich-warte-auf-den-Zahnarzttermin-Modus”, der just dann unterbrochen wird, wenn du im Wartezimmer sitzt und die Schmerzen urplötzlich weg sind. Kennst du dieses Phänomen auch, liebe Leserin und lieber Leser?
Vom Leben gelehrt oder vielleicht einfach über die Jahr schlauer geworden, sagte ich den Termin aber nicht ab. (Lobendes Schulterklopfen!). Ich wusste, dass nicht plötzlich alles wieder gut war, dass sich schon morgen eine geistiger Panne haben könnte.
So setzte ich mich dann also an einem Freitagnachmittag Mitte Januar ins Auto und formulierte im Geist das Ziel meiner Therapiesitzung: „Mir geht es heute sehr gut. Aber die letzten Monate waren ätzend. Der Zeiger auf meiner Mindsetuhr ist weit vor die Zwölf gerutscht. Ich wünsche mir, dass er sich wieder in Richtung Zwölf bewegt und längerfristig bei der Zwölf landet.“
Dies teilte ich dann in einem sehr schön eingerichteten Raum auf einem gemütlichen Stuhl in ansprechender Atmosphäre bei heimeligen Kerzenlicht der Psychotherapeutin, die mir schon bei der Begrüßung an der Tür sympathisch gewesen war, mit.
Nach einem kurzen Kennenlerngeplänkel blieb sie dann zunächst bei den gynäkologisch-medizinischen Fakten:
Ich war weder depressiv. Noch geburnoutet. Noch zu nah am Wasser gebaut. Ich befand mich schlicht und ergreifend in den Wechseljahren. Künstlich und zu früh. Aber mit denselben Auswirkungen wie wenn ich in ein paar Jahren auf natürlichem Weg hineingekommen wäre. Dazu kam der Brainfog, den ich ich mir ja schon ergoogelt hatte und nun ärztlich bescheinigen ließ.
Ja, die die Watte in meinem Kopf war da und gehörte zu den Begleiterscheinungen der Medis bzw. waren ein Symptom der Wechseljahre, die von den Medikamenten ausgelöst wurden.
Diese durchleben alle Frauen irgendwann. Das Ende der Periode. Ein verlangsamter Stoffwechsel. Schlaffere Haut. Schlechterer Schlaf. Hitzewallungen. Zunehmende Vergesslichkeit. Das trifft alle.
War mir bzw. allen Frauen in der Antihormontherapie nicht vergönnt ist, ist die Chance auf ein langsames Herantasten. Die Zeit mit Tamoxifen hatten mir schon einen Vorgeschmack gegeben, aber Trenantone setzte mich nun in einem WechselMOMENT komplett auf Null.
Diesen Hormonentzug stecken die wenigsten Frauen einfach so weg. Fragt man nach oder hört man genauer hin, was unter Freundinnen 50+ so gesprochen oder worüber in Frauenzeitschriften oft geschrieben, dann bekommt man die unglaublichsten Geschichten zu hören. Die Wechseljahre sind wie der Krebs ebenfalls ein Tabuthema.
Ich gebe ihnen hier auf meinem Krebsblog sehr gerne Raum. Frauen, lasst uns viel mehr und viel lauter darüber reden, wie es sich anfühlt, wenn einem plötzlich das Körpergefühl entgleitet, man im Spiegel plötzlich in ein anderes Gesicht blickt und man sich plötzlich in neuen Emotionsregionen bewegt. Wenn plötzzlch ganz viel in und an einem sich verändert und man quasi nochmal eine Pubertät durchlebt.
Nach den Fakten wurde es dann fast poetisch. Denn meine Therapeutin gab mir ein wundervolles Bild mit auf die weitere Fahrtstrecke auf der Antihormontherapieautobahn oder auf der Lebensstraße überhaupt.
Ich solle mir vorstellen, dass an meinen Wattetagen, in meinen Heulphasen und mir-wächst-alles-über-den-Kopf-Momenten Warnleuchten blinken. Diese gäben mir einen Hinweis darauf, dass ich langsamer machen oder vielleicht auch ganz stoppen solle.
Ich musste meine Befindlichkeit nicht ausblenden und im Alltag, im Job und auch privat zu funktionieren wie an anderen Tagen auch. Wenn ich benebelt war, dann war das so.
So wie im echten Leben Warnleuchten auf verengte Straßen, Unfallstellen oder Krötenwanderungen hinwiesen und ich automatisch auf die Bremse drückte, gaben die Warnlampen in meinem Kopf mir an diesen Tagen die Erlaubnis bzw. den Befehl geben, etwas langsamer zu machen. Mich aus Situationen herauszuziehen. Termine abzusagen. Aufgaben zu delegieren. Oder einfach auch mal eine Motztirade in den heimischen vier Wänden abzufahren.
Nein, ich musste meine Befindlichkeit nicht ausblenden und versuchen, meine Rolle zu spielen. Im Gegenteil: Ich durfte müde, motzig, launisch sein. Vielleicht wollte ich das sogar ein Stückweit? Um meiner Umwelt zu zeigen: „Hey, bei mir ist was los, auch wenn ihr alle meint, dass in meinem Leben alles super ist, nur weil es von außen betrachtet so wirkt.“ Machte ich vielleicht unbewusst die Warnleuchten selbst an so wie wenn ein Teenager mit Absicht zum Sonntagsessen mit der Oma in der zerrissenen Jeans kommt oder das Kleinkind den Trotzanfall an der Supermarktkasse hat. So wird man auf jeden Fall wahrgenommen. Hat was der Gedanken…
Was auf jeden Fall auch was hatte, war die Erkenntnis, dass ich irgendwann aus diesen Wechseljahrbefindlichkeiten herauskäme. So wie eine Umleitung irgendwann wieder geöffnet wird und die Warnleuchten dann abgebaut werden, so wäre ich irgendwann wieder unbenebelter unterwegs. Der Straßenbelag ist vielleicht ein anderer, so wie mein Gesicht vielleicht ein faltigeres sein wird. Aber vielleicht ist der neue Fahrtweg aber auch einer mit weniger Kurven und gefällt mir viel besser so wie mir einiges an diesem „Ich werde älter, na und?!“ schon ne ganze Weile ziemlich gut gefällt.
Mit meiner Therapeutin hatte ich einige der Päckchen der letzten Wochen auspacken und genauer anschauen önnen. Nach einer Nach einer guten Stunde verließ ich gut gelaunt mit der für mich total stimmigen Warnleuchtenmetapher leichtfüßig die Praxis. Ich hatte Schwere dortlassen dürfen. Danke, liebe Frau W.
Frohen Mutes ging ich in die nächsten Tage und Wochen und ließ regelmäßig die Warnleuchten blinken und verkrümelte mich in unseren Waschraum. (Ja, liebe Familie da sitze ich manchmal ein paar Minuten länger als ich zum Beladen der Waschmaschine oder zum Ausräumen des Trockners bräuchte und weine oder motze vor mich hin.). Sagte ein Treffen ohne Notlüge, sondern ganz ehrlich – „Ich bin heute nicht in Stimmung dafür.“ ab. Und meckerte auch mal ganz bewusst ganz laut vor mich hin, wenn ich allein im Haus war. Die Betten machen sich mit Wut sowieso viel besser!
Im Nachgang erhellten die Warnleuchten noch einiges mehr für mich. Ich erkannte, dass ich meine Befindlichkeit in Szene setze. Es ist absolut ok, wenn es eben manchmal nicht ok war. Im Lichte der Warnleuchten besehen, hatte ich in den letzten Jahren schließlich schon einige Turbulenzen und ausreichend Dramatik in meinem Leben gehabt. Der Unfalltod meines Bruders. Ein Notkaiserschnitt, der mir das Leben rettete. Ein weiterer Kaiserschnitt. Noch einer. Ein Hausbau. Eine Pandemie. Eine Brustkrebsdiagnose. Ja, im Warnleuchtenlicht betrachtet, hätte jeder einzelne dieser Punkte mir die Erlaubnis für den ein oder anderen Kopfnebeltag gegeben. Wenn man dann noch den Familienalltagsstress in Kombination mit beruflichen Ambitionen und Verpflichtungen wie Arztterminen sieht, dann kann man schon sagen: Das kann einem doch auch mal zu viel werden und dann ist es logisch, dass der Kopf sich in Nebel hüllt und mich so vom trubeligen Außen ins ruhige Innen lenkt.
Beim Schreiben des Textes verstand ich, dass die Warnleuchten wohl schon da waren, seit ich die erste Tamoxifentablette geschluckt hatte. Damals waren sie allerdings im gedimmten Modus gewesen und das Licht hatte mich nicht sonderlich gestört. Als dann die Trenantoneladungen kamen, wurden sie dann so grell, dass sie mich blendeten wie ein plötzlich auftauchendes Auto in einer regnerischen Nacht. Ich erschrak, fuhr kurz rechts an, atmete durch und nahm dann meinen Weg wieder auf und spulte automatisiert alles im Alltag und Beruf ab.
Ich hätte vielleicht etwas genauer auf den Song achten sollen, der im Autoradio lief. Sang da ein Sänger mit ähnlicher Frisur wie ich sie habe, nicht davon, dass er von Lichtern geblendet ist („I´m blinded by the lights“), er nicht schlafen („I can´t sleep“) und sowieso nicht mehr klarsehen kann („I can´t see clearly“). Während er in der Dunkelheit ertrank („I´m drowning in the night“) ertrank ich immer mehr in meinem Wechseljahrmoment mit depressivem Touch.
Bis ich dann wieder mal unterwegs, erneut geblendet wurde und mit einem schon mulmigeren Gefühl am Straßenrand meines Lebens saß. Denn eine Situation wie die, als ich auf meine ach-so-geliebte-Nordsee blickte und sich das „Ich-fühle-mich-frei-Gefühl“ nicht einstellte, ließ mich erkennen, dass da etwas nicht stimmte.
Das brachte mich dann schlussendlich zur Therapeutin und zur Warnleuchtentheorie und zu diesem Text.
Am Ende desselben stelle ich mich mal etwas entfernt vom ganzen Geschehen in meinem Innen wie im Außen auf. Und sehe ganz klar, obwohl ich im Schatten sitze.
Ich bin absolut fein mit den Medikamenten, die ich bekomme. Sie ebnen mir im besten Fall den Weg in ein langes, gesundes Leben. Sie sind ein Segen und ich bin voller Dankbarkeit für diese medizinischen Möglichkeiten, mit denen meine Erkrankung behandelt werden kann.
Ich gestehe mir aber auch zu, dass diese Medikamente eben nicht nur „so ein bisschen Medizin“ sind, sondern doch etwas mehr Wumms haben als eine Halspastille und definitiv etwas mit mir, meinem Körper und meinem Wesen machen.
Und das fühlt sich an manchen Tagen supergut und an manchen Tagen megadoof an. Manchmal nervt es mich. Manchmal nehm´ ich es gelassen hin..
Manchmal bemitleide ich mich selbst. Manchmal weine ich einfach.
Schön, dass ich mich dann immer wieder hier auf meinen Blog in einem langen Text darüber auslassen oder mit meiner Therapeutin darüber sprechen kann.
Von leichten und schweren Päckchen
Jetzt mal unter uns, liebe Leserin und lieber Leser: Du kennst dieses supergute-megadoofe-Tage-Ding doch auch, oder? Egal, ob du auf hinter oder vor mir auf der Antihormontherapieautobahn unterwegs bist oder du damit nichts zu tun hast. Denn hinter jedem Mensch steckt eine Geschichte und jede und jeder von uns hat doch irgendein Päckchen zu tragen. Das ist für unser Umfeld oft nicht erkennbar, weil wir uns nach außen hin im Griff haben.
Ich weiß nicht, ob du einen peppigen Kurzhaarschnitt hast oder eine ungewollte Nach-Chemofrisurweiß. Ich weiß nicht, was dich körperlich schmerzt oder seelisch belastet. Ich weiß nicht, was dir in deinem Leben insgesamt oder ganz konkret heute zugestoßen ist.
Wir blenden quasi mit unserem „gesunden Auftreten“ die anderen. Das zeigte mir ein Gespräch neulich mit den zwei weltbesten Kolleginnen. Irgendwie ergab es sich, dass ich ein bisschen von meinen Querelen in den letzten Monaten berichtete. Eine Kollegin meinte: „Oh, das war mir gar nicht so bewusst. Schön, dass du das heute mal erzählst. Wir kennen dich ja hier an der Schule nur als die immer funktionierende Kollegin.“
Diese Rückmeldung erfreute mich auf der einen Seite. Denn sie bestätigte mich darin, dass ich meinem Anspruch, dass ich in der Schule in der Rolle der Lehrkraft auftrat. Krebsblog und Ehrenamt für Jung und Krebs e.V. gehören selbstverständlich zu mir und ja, ich gestehe!, auch am Tisch im Lehrerzimmer hatte ich schon auf die Wichtigkeit der Vorsorgeuntersuchungen hingewiesen. Aber Schule war dennoch Schule und dort strengte ich mich an Brainfogtagen oder wenn die Hände mal wieder etwas mehr schmerzen oder ich nach einer durchwachten Nacht etwas müde war, noch mehr an als sonst.
Auf der anderen Seite zeigte mir der Satz meiner Kollegin aber auch, dass ich das tat, was ich meiner Umwelt manchmal vorwarf oder worüber ich sogar schon in Blogtexten oder Instaposts geschrieben hatte. Selbstreflexion ist doch einfach immer wieder gut, hihi.
Ich spielte tatsächlich dieses “Alles ist gut”, obwohl es das an manchen Tagen im Leben nach Krebs überhaupt nicht war. Ich hielt die schwache Annette zurück. Die bekamen dann meine vier liebsten Menschen ab. Meine Herzensgang erlebte mich wütend, weinend, ungerecht austeilend. Und auch Freund*innen mussten mit den Nebenwirkungen leben, wenn ich mal wieder ein Treffen absagte. An dieser Stelle: Tausend Dank für euer Verständnis oder euer nicht-kommentierendes Akzeptieren. Danke, Danke.
Ich hatte mich also im Lehrerzimmer von meiner verletzlichen Seite gezeigt und damit auch das Licht auf die Päckchen der anderen gerichtet und so Raum geschaffen für den Austausch. Denn meine Kollegin fügte dann zum Schluss noch hinzu: „Also bei mir war ja gerade auch etwas Trubel daheim.“ Und dann waren wir vor Unterrichtsbeginn noch in ein kurzes, aber gutes Gespräch über private und körperliche Baustellen vertieft.
Mir ist es an dieser Stelle wichtig zu betonen, dass es mir nicht darum geht, mit diesem Text hier um Mitleid für mich und meine Situation zu buhlen. Nö. Denn so wie mir geht es ja zigtausend Frauen da draußen. Wer meinem Blog folgt, weiß, dass 1 von 8 an Brustkrebs erkrankt und ein Großteil davon macht ebenfalls eine Antihormontherapie. Inklusive aller Scherereien oder womöglich noch viel mehr!
Ich habe mithilfe dieses Textes einfach ganz selbsttherapeutisch auf meine eigenen Päckchen schauen wollen. Darin stecken eben ein Tablettenblister und eine Spritze und ab und zu auch etwas Hilflosigkeit und immer wieder auch echte Angst.
Falls du selbst von Antihormontherapienebenwirkungen wie Brainfog und Co. betroffen bist, würde mich total freuen, wenn du aus meinen hier geschilderten Erfahrungen etwas mitnehmen kannst. So könnten wir aus unser beider Schwächemomenten eine Superkraft entstehen lassen.
Vielleicht schleppst du, liebe Leserin oder lieber Leser, auch etwas ganz anderes mit dir herum, das dir benebelte Tage oder schlaflose Nächte bereitet? Lass´ es für eine Weile aufleuchten, damit es auch für andere und nicht zuletzt für mich sichtbar wird. Geteiltes Leid ist ja bekanntermaßen halbes Leid.
Ich habe meinen Frieden mit meiner Situation gefunden. „I´m okay with that“ wie Maggie Rogers so schön singt. Ich lebe ein gutes Leben mit einem tollen Mann, drei wundervollen Kindern, zwei Berufen, die mich begeistern, einem Ehrenamt, das mir Spaß macht und zig anderen Projekten, die mich erfüllen. Und ab und zu da bremsen mich meine persönlichen Warnleuchten eben etwas aus und verlangsamen meine schnelle Lebensfahrt. Hat ja eigentlich auch was sehr vernünftiges und gesundes, nicht immer hochtourig unterwegs zu sein, oder?
Liebe Leserin und lieber Leser, gelingt dir das auch? Erhelle deine Päckchen. Sei stolz auf dich. Auf das, was du körperlich oder seelisch, privat oder beruflich trägst. Gestehe dir deine Empfindungen dazu ein und vorallem auch zu. Was mir leichtfällt, kann für dich schwer sein. Was mich nur leicht zwickt, kann dir echt wehtun. Was mich lachen lässt, verletzt dich möglicherweise.
Und das ist total okay. Du bist auf deiner eigenen Lebensautobahn unterwegs. In deinem eignen Tempo.
Ich werde mir deine Sorgen und Ängste nicht aufladen. Und du dir bitte meine auch nicht. Jede und jeder von uns trägt sein Päckchen bitte weiterhin allein herum. Aber ich glaube, es fühlt sich leichter an, wenn wir alle mit etwas mehr Wohlwollen, Verständnis und Unvoreingenommenheit auf die Päckchen unserer Mitmenschen blicken.
Zum Schluss dieses Textes fände ich es schön, wenn die deine Päckchen für eine Weile in eine schattige Ecke deines Hauses legen würdest. Tanze gemeinsam mit mir und allen, die gerade beim Lesen dieses Textes Lust bekommen haben, im hellen Glitzerschein einer Diskokugel zum Song „Light on“ (Licht an). Für einen Moment zumindest werden wir ohne Päckchenlast ganz unbeschwert sein können. Wundervoll.
Und wenn dann am Ende des Tages jede und jeder von uns allein im Bett liegt, dann lasse ich mein Licht an und du deins, ok? Auf mehrere Schultern verteilt tragen sich unsere Päckchen sicherlich leichter.
Then I’m okay with thatIf you leave the light onThen I’ll leave the light on(Light on, light on, light on)And I am findin’ outThere’s just no other wayThat I’m still dancin’At the end of the dayAnd if you leave the light onThen I’ll leave the light on(Light on, light on, light on)