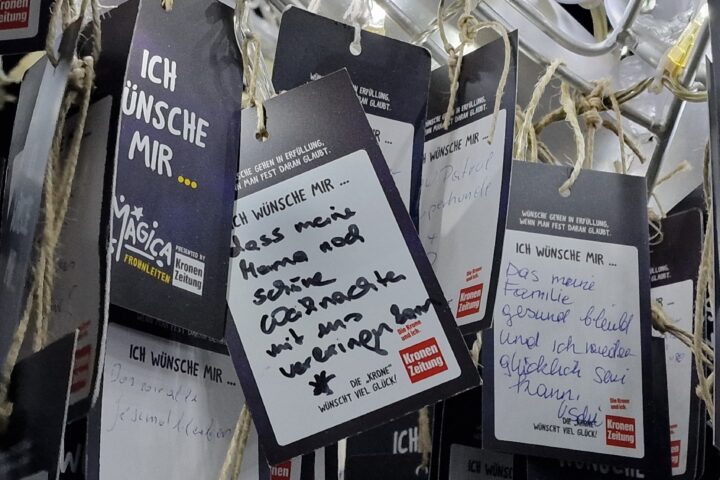BRUST ABTASTEN
Spieglein, Spieglein an der Wand
Manchmal mag ich mich einfach nicht mehr anschauen, meinen Körper, meinen Unterleib, der mir fremd geworden ist. Nerven durchtrennt, enden im Nichts, ihrer Funktion beraubt. Phantomschmerz – unerklärbar für Außenstehende.
Manchmal ist der Blick in den Spiegel unvermeidbar. Dann geht mein Blick starr nach vorn, nur nicht nach unten. Die Narben an meinem Nabel liegen dabei im unteren Grenzbereich. Sie erinnern mich an das, was mir entnommen, was mir genommen wurde. Für immer, unwiederbringlich.
“Es war notwendig”, spricht der Spiegel zu mir. “War es das?”, frage ich ihn, frage ich mich. “Du wärst nicht mehr am Leben”, sagt mein Gegenüber. “Aber der Krebs ist zurückgekommen”, erwidere ich trotzig. Der Spiegel darauf schon fast etwas wütend: “Deshalb bekommst Du auch neue Medikamente, damit Du lebst. Aber warum muss i c h Dir das sagen. Das musst Du Dir selber sagen! Das kann Dir keiner abnehmen.”
Manchmal können Spiegel entwaffnend ehrlich sein.